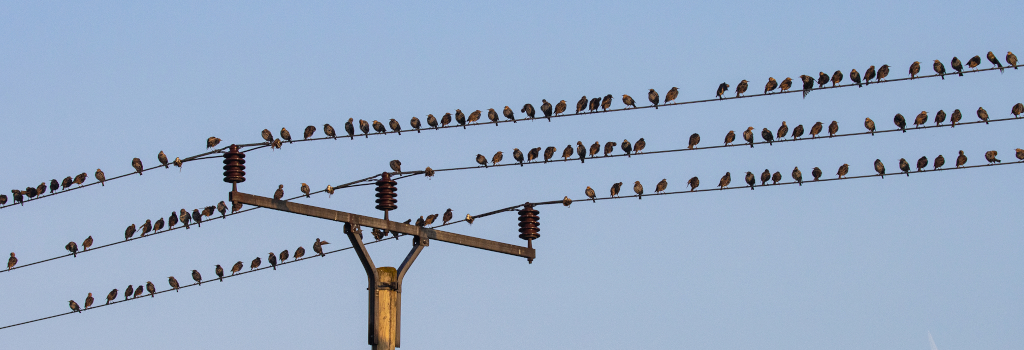Aktuelle Meldungen
12.01.2026
Neuer Möwenrundbrief – Treffen und Pflegeeinsatz
Die AG Möwen trifft sich am 20./21.02 und sucht noch Zählende.
Möwen sind im Winterhalbjahr vor allem im Tiefland von NRW ein häufiger Anblick an Gewässern und in der offenen Landschaft. Sie verbringen die Nächte meist an Gemeinschaftsschlafplätzen, die oft seit vielen Jahren besetzt werden. Hier werden sie von Mitgliedern unserer AG Möwen im Rahmen der Schlafplatzzählungen erfasst.
Erfreulich ist, dass mit dem Aasee in Münster nun wieder Daten von einem wichtigen Zählgebiet in Westfalen vorliegen. Lücken in der Datenerfassung haben wir dagegen vor allem noch im Landesteil Nordrhein. Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wer mitzählen möchte, kann sich gerne bei der AG Möwen melden. Die Schlafplatzzählung umfasst drei abendliche Zählungen im Jahr und benötigt daher nur einen überschaubaren Aufwand. Natürlich ist die Bestimmung einiger Großmöwen eine Herausforderung, andererseits ist das Artenspektrum sehr übersichtlich, so dass die Einarbeitung vergleichsweise schnell erfolgen kann. Im Rahmen abendlicher Zählungen ist auch nicht immer eine Erfassung auf Artniveau möglich bzw. gefordert. Je nach Zählgebiet ist aber oft ein Spektiv erforderlich.
Die Zählenden werden sich am 20./21.02. in Absprache mit der Biologischen Station Zwillbrocker Venn treffen und dort im Rahmen eines Pflegeeinsatzes die Brutinsel der Möwen freischneiden, so dass die Vögel zur Brutzeit wieder geeigneten Lebensraum vorfinden. Wer dort als Tagesgast mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen. Bei Interesse am Pflegeeinsatz bzw. der Teilnahme an den Zählungen melden Sie sich bitte bei Jörg Hadasch an.
Weitere Informationen zur Schlafplatzzählung der AG Möwen und alle Rundbriefe finden Sie hier.
12.01.2026
Einladung zur Mitgliederversammlung und Jahrestagung der NWO
Die diesjährige Mitgliederversammlung und Jahrestagung der NWO findet am 01. März 2026 in der NUA in Recklinghausen statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Beiträgen erwartet alle ornithologisch Interessierten im Land!
Am Vormittag findet von 09:30 bis 11:00 Uhr unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Nach einer Kaffeepause beginnt um 11:00 Uhr die Jahrestagung mit einem spannenden Programm. Bettina Fels wird zu Neuem aus der Vogelschutzwarte berichten. Nach dem Bericht der AviKom (Tobias Rautenberg und Daniel Hubatsch), bei dem uns tolle Fotos von der ein oder anderen Seltenheit ertwarten, geht es mit Bildern weiter: Das Vogelquiz (von Daniel Duff und Michael Schmitz) gehört mittlerweile zu unserer Tagung dazu und bietet allen die Möglichkeit, eigene Fähligkeiten in der Vogelbestimmung zu testen. Wie gewohnt wird es schöne Preise geben und natürlich jede Menge Ruhm, Ehre und die Erkenntnis, dass ausgerechnet die Art, an die man wahlweise als erstes oder zweites gedacht hat, die korrekte Auflösung gewesen wäre.
Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Mittagspause mit Christoph Randler aus Tübingen einen exzellenten Redner von außerhalb gewinnen konnten. Er ist selbst nicht nur Birder, sondern lehrt auch an der Uni Tübingen. Er wird uns in seinem Vortrag auch ein bisschen den Spiegel vorhalten, sind Vogelbeobachtende doch seine bevorzugte soziologische Studiengruppe. Auf den neuesten Stand bei ADEBAR 2 wird uns im Folgenden Ralf Joest bringen, bevor Bruno Walther das sicherlich schon von vielen erwartete neue Steinkauz-Modul im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel vorstellen wird.
Die beiden Abschlussvorträge sind zwei sehr charismatischen Vogelarten unseres Bundeslandes gewidmet: Christine Kowallik et al. entführen uns von den Brutgebieten der Zwerggänse in Schweden hin zu den Überwinterungsgebieten hier bei uns in NRW. Stefan R. Sudmann und Barbara Meyer stellen am Ende die provokante Frage, ob Ziegenmelker Scooter mögen.
Genügend Pausen bieten Zeit zum vogelkundlichen Austausch zwischendurch. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt (wir bitten um Spenden!). Die Einladung und das vollständige Programm kann hier heruntergeladen werden. Die Einladung erscheint außerdem im nächsten Charadrius-Heft. Gäste sind herzlich willkommen.
08.01.2026
Aktuelles Winterwetter – Welchen Einfluss haben Schnee und Eis auf die Vogelwelt?
Es ist Winter in NRW und Mitteleuropa. Aufgrund des Klimawandels sind Wetterlagen mit Schnee und Eis seltener geworden, aber natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen – Wetter ist schließlich nicht gleich Klima. Aber welchen Einfluss hat das aktuelle Winterwetter auf heimische Wildvögel?
Einerseits sind unsere Vögel an den Winter evolutionär angepasst, andererseits stellen Eis und Schnee durchaus eine Herausforderung dar und nicht alle Vogelindividuen überleben den Winter. Wir haben immer wieder über das Thema an verschiedenen berichtet und wollen an dieser Stelle einige wichtige Informationen für Euch und Sie kompakt zusammenstellen.
Viele Strategien, wie Vögel mit dem Winter umgehen haben wir in der folgenden Übersicht aufgezählt und beschrieben. Von Winterflucht bis Winterschlaf bei Vögeln (kein Scherz) ist einiges dabei:
Was machen Vögel im Winter?
Am bekanntesten ist aber vielleicht der Vogelzug – viele Zugvögel sind nun im warmen Süden:
Wie weit ziehen Zugvögel?
In kalten Wintern kommt es in Folge von Winterflucht manchmal zu Invasionen nordischer Vögel, meist allerdings erst, wenn dort das Futter sehr knapp wird. In diesem Winter gibt es einige Meldungen weißköpfiger Schwanzmeisen, aber Birkenzeisige, Erlenzeisige oder auch Seidenschwänze scheinen sich bisher rar zu machen
Was sind Invasionsvögel?
Eine Besonderheit von vielen Vögeln ist die Tatsache, dass Vögel nicht so leicht kalte Füße bekommen. Hilfe dabei leistet das sogenannte Wundernetz:
Warum frieren Vögel im Winter die Füße nicht ein?
Natürlich hilft es auch, wenn ein Bein im Gefieder verborgen ist:
Warum stehen Vögel auf einem Bein?
Und natürlich geht es oft nicht um Schnee oder Kälte per se, sondern darum genügend Futter zu haben. Einige Vögel betreiben daher Vorratshaltung und haben sogar „Kühlschränke“:
Warum kommt der Kleiber so oft ans Futterhaus – Vorratshaltung bei Vögeln?
Schnee und kalte Temperaturen halten manche Vögel allerdings keineswegs vom Singen ab:
Warum singen Vögel aber im Winter?
Genügend Lesestoff also für das nächste Tiefdruckgebiet mit Regen, Glatteis, Schnee und Sturm und sicherlich immer noch nicht allumfassend. Wenn Sie weitere Wünsche für zukünftige „FAQ“ haben, schreiben Sie uns gerne (geschaeftsstelle@nw-ornithologen.de!
06.01.2026
Wintergänse – neuer Rundbrief und Bericht
NRW ist Gänseland. Im Tiefland des Rheinlandes und Westfalens überwintern zahlreiche Gänse und Schwäne. Ein neuer Bericht gibt Überblick über die Entwicklung der Maximalbestände und aktuelle Muster von 2022 bis 2025.
Auch aus diesem Winter liegen bereits erste vorläufige Daten vor: Die Ankunft der Blässgänse im Herbst erfolgte demnach erneut verzögert, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen. Bei den Tundrasaatgänsen sind die Daten noch nicht repräsentativ, aber hier könnte es ein ähnliches Muster geben. Leider gibt es außerdem auch in diesem Winter wieder Fälle von hochpathogener avirärer Influenza (HPAI, „Geflügelpest“ oder „Vogelgrippe“), von der nicht nur Kraniche, sondern auch Gänse und Schwäne betroffen sind. Aus dem Herbst liegt ein unterdurchschnittlicher Anteil an Jungvögeln vor, was auch einen geringen Bruterfolg im letzten Jahr hinweist. Allerdings kommen Familien auch anscheinend erst später in den Überwinterungsgebieten an. Im Rahmen der Gänse- und Schwanenzählung werden außerdem regelmäßig Ringe abgelesen. Die Beringungsaktivitäten in den Brutgebieten Ruslands wurden aber mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine eingestellt, so dass aktuell deutlich weniger beringte Gänse beobachtet werden. Ohne gezielte Suche nach beringten Vögeln werden übrigens auch seltenere Gänse wie Zwerggans, Kurzschnabelgans und sogar Rothalsgans seltener festgestellt. Am 17. und 18. Januar ist die internationale Schwanenzählung. Im Fokus stehen vor allem Sing- und Zwergschwan, die in NRW aber mittlerweile selten geworden sind. Stattdessen liegt hier und deutschlandweit der Fokus auf dem Höckerschwan. Spannend wird zu beobachten sein, ob der aktuelle Wintereinbruch bis dahin noch zu Verschiebungen führen wird.
Der vollständige Rundbrief kann hier heruntergeladen werden. Der Bericht für die Jahre 2022 bis 2025 ist ebenfalls online hier verfügbar. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird außerdem eine ausführliche Arbeit zu den Wintergänsen in NRW im Charadrius erscheinen. Darüber werd wir dann selbstverständlich gesondert berichten.
Die AG Gänse bedankt sich ganz herzlich bei allen Aktiven, die sich an der Gänse- und Schwanenzählung beteiligen! Die Erstellung des Berichtes und die Koordination des GuS-Monitorings wurde dankenswerterweise mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW gefördert.
05.01.2026
Grauammern im Winter gesucht
Wie schon in den letzten Jahren rufen wir zum Jahresanfang dazu auf, gezielt Grauammern zu suchen und zu melden.
Die Grauammer ist eine typische Art der Agrarlandschaften. In NRW gibt es noch Vorkommen in den rheinischen Börden und der westfälischen Hellwegbörde. Wie viele andere Feldvögel gehört sie bei uns zu den stark im Bestand zurückgehenden Arten. In jüngster Zeit sind aber in einigen Regionen, wie zum Beispiel der westfälischen Hellwegbörde, leichte Zunahmen erkennbar. Dies betrifft sowohl die Zahl der Brutreviere als auch die Feststellungen von Grauammertrupps im Winter. Da die Art auch den Winter bei uns sind ist sie auf ein ausreichendes Nahrungsangebot angewiesen. Gerne sucht sie daher Vertragsnaturschutzflächen wie Blühflächen, Brachen oder nicht geernetetem Getreide auf. Die Biologischen Stationen der Kreise Bonn-Rhein-Erft, Düren, Euskirchen und Soest führen in der ersten Januarwoche eine abgestimmte Erfassung überwinternder Grauammern in den regionalen Schwerpunktgebieten durch. Darüber hinaus sind aber alle weiteren Winterbeobachtungen der Art aus NRW interessant. Vogelbeobachter:innen werden daher gebeten, in den kommenden Wochen verstärkt auf die Art zu achten und ihre Beobachtungen bei ornitho.de zu melden./p>
17.12.2025
Grüße zum Jahresende
Die NWO-Geschäftsstelle ist einige Tage nicht erreichbar. Wir sind im neuen Jahr wieder da und wünschen Euch und Ihnen schöne Feiertage und ein vogelreiches Jahr 2026.
Wir hoffen, Sie finden zwischen den Jahren etwas Zeit, ein bisschen Vögel zu beobachten. Diejenigen, die noch auf der Suche nach guten Vorsätzen für das neue Jahr sind, laden wir ein, sich an den Kartierungen für ADEBAR 2 zu beteiligen und/oder beim Vogelmonitoring mitzumachen. Tragen Sie zu einem besseren Verständnis unserer Vogelwelt bei, liefern Sie wichtige Datengrundlagen für den Naturschutz und tun Sie gleichzeitig durch Aktivitäten draußen etwas Gutes für sich selbst. Und noch etwwas, vergessen Sie nicht, im Bekannten- und Freundeskreis eifrig Werbung für die NWO zu machen. Vogelkunde und Vogelschutz in NRW braucht mehr Unterstützung!
Kathrin Schidelko & Darius Stiels
12.12.2025
Aus unserer AG Weißstorch: Sympathieträger im Aufwind – von drei auf über 1.000 Brutpaare in 34 Jahren
Die Rückkehr des Weißstorches in Nordrhein-Westfalen ist einer der größten landesweiten Artenschutzerfolge der letzten Jahrzehnte. Von drei Paaren im Jahr 1991 erfolgte eine Bestandszunahme auf, nach aktuellem Datenstand, 1.025 Brutpaare im Jahr 2025 mit insgesamt 1.540 ausgeflogenen Jungvögeln. Erstmalig hat der Weißstorch die Marke von 1.000 Brutpaaren überschritten – der Höchstbestand seit der neuzeitlichen Besiedlung von Nordrhein-Westfalen im 15./16. Jahrhundert.
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in ganz Deutschland, die Art befindet sich mit rund 13.000 Paaren ebenfalls auf einem Rekordwert. Die in der Bevölkerung beliebte Vogelart profitiert in NRW von zahlreichen Naturschutzmaßnahmen, günstigen Umweltbedingungen, verkürzten Zugstrecken und vom lokalen Engagement vieler Akteurinnen und Akteure. Herzlichen Dank an alle Personen, die am Weißstorch-Monitoring mitgewirkt haben. Der Kreis Minden-Lübbecke bleibt landesweit der Weißstorchkreis Nummer 1 mit dokumentierten 190 Brutpaaren, gefolgt vom Kreis Wesel mit 114 Brutpaaren. Hohe Siedlungsdichten wurden 2025 auch in den Kreisen Paderborn, Soest, Kleve sowie in der Stadt Münster erreicht. In den letzten Jahren sind verstärkt Baumbruten zu beobachten; aus hiesiger Sicht hat die Art aktuell kein Nistplatzproblem.
Viele Störche aus NRW überwintern auf der Iberischen Halbinsel. Aktuell erreichen uns Nachrichten, dass in Spanien über 500 verendete Störche aufgefunden wurden. Neben dem Kranich sind leider auch Weißstörche von der „Vogelgrippe“ (HPAI – hochpathogene aviäre Influenza) in besonderem Maße betroffen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der bisherige Aderlass im Winterquartier auf unseren Brutbestand 2026 auswirkt.
Michael M. Jöbges
08.12.2025
Rückblick ADEBAR-Tagung und Adventskolloquium
Am Samstag, den 06.12. fand unsere erste offizielle ADEBAR-Tagung statt. Knapp 100 Vogelbegeisterte trafen sich dazu im LWL-Landeshaus in Münster (inoffiziell auch als „Westfalenparlament“ bekannt).
Es begann morgens mit einem der vielleicht aufregendsten Projekte, die aktuell im Vogelschutz in Deutschland durchgeführt werden: David Schuhwerk berichtete über das LBV-Bartgeier-Projekt, der Wiederansiedlung des größten Greifvogels Europas in den Berchtesgadener Alpen. Ralf Joest gab nach einem erfolgreichen Start in die erste ADEBAR-Saison in NRW einen Überblick über den Stand der Dinge und machte Lust auf mehr. In die gleiche Kerbe schlug Kathrin Schidelko mit ihrem Überblick über die aktuellen Programme und Module im Rahmen des Vogelmonitorings. Eulenfans können sich ab 2026 auf ein neues Modul freuen: Bruno Walther stellte die Steinkauzerfassung im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel vor, die nächstes Jahr beginnen wird.
Nach einem leckeren Mittagessen ging es nachmittags mit ADEBAR weiter: Jonas Brüggeshemke vom DDA stellte die Werkzeuge vor, mit denen die ersten ADEBAR-Ergebnisse nun auch ausgewertet werden können. Den Abschlussvortrag gab Kevin Vuaginaux vom NABU Krefeld/Viersen, der von einer Erfolgsgeschichte zu erzählen wusste: das erste Fischadlerrevier an den Krickenbecker Seen in den Jahren 2024 und 2025 gibt Anlass zur Hoffnung, dass auch regional bereits bei uns ausgestorbene Arten NRW wiederbesiedeln können, sofern die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. Michael Jöbges und Birgit Beckers leiteten kurzweilig durch die Veranstaltung. Ausgiebige Pausen sorgten außerdem dafür, dass der gegenseitige ornithologische Austausch, Fragen und Diskussionen ebenfalls nicht zu kurz kamen.
Wir danken dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stellte uns dankenswerterweise die Räumlichkeiten zur Verfügung.